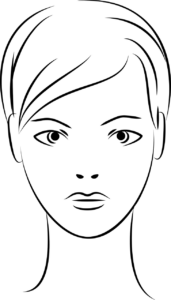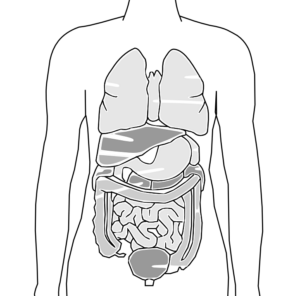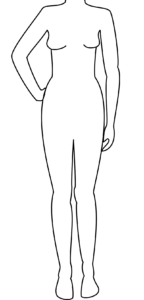Nebenwirkungen
Eine orale Krebstherapie kann – wie alle anderen Medikamente – Nebenwirkungen auslösen. Wichtig für Sie ist jedoch zu wissen, dass man vielen häufigen Nebenwirkungen durch einfache Tipps, Verhaltensmaßnahmen oder den gezielten Einsatz von Prophylaxen vorbeugen kann. Das bezeichnet man auch als unterstützende Therapie oder Supportivtherapie.
Supportivtherapie ist ein sehr wichtiger Baustein jeder Krebsbehandlung, da dadurch Nebenwirkungen seltener auftreten und viel weniger stark ausgeprägt sind. Beschwerden, denen man in vielen Fällen gut vorbeugen kann, sind zum Beispiel Hautreaktionen, Müdigkeit, Übelkeit und Entzündungen der Mundschleimhaut.
Bitte beachten Sie, dass alle Informationen und Tipps die Sie hier finden nicht das Gespräch mit Ihrer behandelnden Ärztin oder Ihrem behandelnden Arzt ersetzen können – und auch gar nicht sollen! Wenden Sie sich deshalb bitte bei plötzlich neu auftretenden, sehr starken oder anhaltenden Beschwerden unbedingt immer an Ihr Behandlungsteam. Dieses kennt Sie, Ihre Erkrankung und ggf. Ihre anderen Medikamente am besten und kann gemeinsam mit Ihnen entscheiden, was zu tun ist, um die Nebenwirkung schnell wieder in den Griff zu bekommen.
In den folgenden Abschnitten haben wir die wichtigsten Informationen zu häufigen Nebenwirkungen oraler Tumortherapien für Sie zusammengefasst.
Tipp: Sie möchten weitere Informationen oder sich die Tipps zum Nachlesen ausdrucken? Nutzen Sie unsere Nebenwirkungsmerkblätter als PDF. Diese finden Sie am Ende jedes Abschnitts – achten Sie auf das Download-Symbol!
Wählen Sie die Nebenwirkung aus, über die Sie mehr erfahren möchten:
Sie können mögliche Beschwerden über den betroffenen Körperteil oder -bereich auswählen. Alternativ können Sie die Nebenwirkung in der darunterliegenden Liste alphabetisch auswählen.
Wichtig zu wissen: Bitte seien Sie nicht erschrocken von der Fülle der hier dargestellten Nebenwirkungen. Es handelt sich hierbei lediglich um mögliche Beschwerden. Es gibt inzwischen sehr viele verschiedene orale Krebsmedikamente, die unterschiedliche Nebenwirkungen auslösen können. Je nachdem welches orale Tumormedikament Sie erhalten, kann es deshalb sein, dass nur ein kleiner Teil der hier beschriebenen Nebenwirkungen für Ihre persönliche Behandlung von Bedeutung ist! Wenn Sie unsicher sind, welche Nebenwirkungen bei Ihrer Behandlung auftreten können, fragen Sie Ihr Behandlungsteam um Rat.
Bildquellen: modifziert nach Pixabay (OpenClipart-Vectors, Clker-Free-Vector-Images)
Durchfall
Durchfall – von Fachleuten auch Diarrhö genannt – ist eine sehr häufige Nebenwirkung vieler oraler Krebsmedikamente.
Wichtig zu wissen ist, dass Stuhlfrequenz und -beschaffenheit von Mensch zu Mensch unterschiedlich sind. Von Durchfall spricht man, wenn pro Tag 3 oder mehr Stuhlgänge als üblich auftreten. Meist ist der Stuhlgang ungeformt bis wässrig und es können dabei Bauchschmerzen oder -krämpfe auftreten.
Worauf sollten Sie achten, wenn Durchfall auftritt?
- Trinken Sie ausreichend, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen! Mindestens 2 bis 3 Liter pro Tag stilles Wasser, Kräutertee oder Brühe. Sportgetränke sind ebenfalls gut geeignet, um den Verlust von Salzen (Elektrolyten) auszugleichen. Achten Sie nur darauf, dass diese keinen Grapefruit- oder Bitterorangensaft enthalten, da es zu Wechselwirkungen mit Ihren Medikamenten kommen kann!
- Meiden Sie schwer verdauliches, fettes Essen, Alkohol, kohlensäurehaltige Getränke und Kaffee. Setzen Sie stattdessen auf leicht verdauliche Lebensmittel und verzichten Sie vorübergehend auf lactosehaltige Milch und Milchprodukte!
- Indische Flohsamenschalen können unterstütztend wirken – achten Sie hier nur darauf, mindestens 30-60 Minuten Abstand zu Ihren Medikamenten einzuhalten
- Wenn Ihr Krebsmedikament sehr häufig Durchfall auslöst, hat Ihre Ärztin / Ihr Arzt Ihnen wahrscheinlich ein Medikament gegen Durchfall mit dem Wirkstoff Loperamid verschrieben. Nehmen Sie es bei den ersten Anzeichen von Durchfall so ein, wie es Ihnen Ihre Ärztin/Ihr Arzt gesagt hat!
Wann müssen Sie Ihre Ärztin / Ihren Arzt kontaktieren?
- Wenn der Durchfall trotz der oben genannten Tipps und der Einnahme von Loperamid länger als 12 Stunden anhält
- Bei sehr starkem oder sehr häufigem Durchfall
- Bei blutigen Durchfällen
- Wenn Sie zusätzlich Fieber (über 38 Grad) oder weitere Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen oder Bauchkrämpfe haben
Entzündungen der Mundschleimhaut
Eine Schleimhautentzündung (sogenannte Mukositis) kann bei der Behandlung mit oralen Krebsmedikamenten auftreten, besonders bei klassischen Zytostatika (z.B. Capecitabin, Temozolomid). Diese Medikamente schädigen vor allem schnell teilenden Zellen, wozu auch die Schleimhautzellen im Magen-Darm-Trakt zählen. Besonders häufig ist die Mundschleimhaut betroffen, dann spricht man von Stomatitis.
Typische Anzeichen sind Rötungen, offene Stellen, Schmerzen sowie Mundtrockenheit.
Worauf sollten Sie vorbeugend achten?
- Vor Beginn der Therapie ist eine zahnärztliche Untersuchung ratsam, um mögliche Entzündungsherde oder Druckstellen zu beseitigen
- Eine gründliche Mund- und Zahnpflege ist die beste Möglichkeit einer Mundschleimhautentzündung vorzubeugen
- Führen Sie häufig Mundspülungen mit alkoholfreien Lösungen oder Wasser durch (mindestens nach jeder Mahlzeit und vor dem Zubettgehen)
- Nutzen Sie eine weiche Zahnbürste und eine milde, fluoridhaltige Zahnpasta
- Vermeiden Sie reizende Speisen und Getränke sowie Alkohol und Rauchen
Was können Sie tun, wenn Beschwerden auftreten?
- Intensivieren Sie die Mundspülungen (4 bis 6 mal täglich)
- Bevorzugen Sie weiche, flüssige Lebensmittel
- Hochkalorische Trinknahrung („Astronautenkost“) kann vorrübergehend sinnvoll sein, wenn normales Essen schwerfällt
- Lutschen Sie Eiswürfel
- Meiden Sie reizende Speisen und Getränke
- Ergänzend stehen spezielle wirkstoffhaltige Mundspüllösungen zur Verfügung. Bei starken Schmerzen können Schmerzmittel oder lokalanästhetische Wirkstoffe helfen, die Ihnen Ihre Ärztin/Ihr Arzt verschreiben kann
Wann müssen Sie Ihre Ärztin / Ihren Arzt kontaktieren?
- Bei weißen Flecken im Mund
- Bei starken Schmerzen
- Wenn Sie unzureichend essen können
Ernährungsschwierigkeiten
Während einer Krebstherapie können verschiedene Nebenwirkungen auftreten, die zu Ernährungsschwierigkeiten führen können. Häufige Herausforderungen sind Geschmacksstörungen, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust.
Es ist wichtig, dass Sie sich regelmäßig wiegen und Ihre Ärztin / Ihren Arzt frühzeitig informieren, wenn Sie an Gewicht verlieren. Aus Studien weiß man, dass ein guter Ernährungszustand dazu beitragen kann, dass Sie mehr von Ihrer Krebstherapie profitieren und diese besser vertragen.
Was können Sie bei Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust tun?
- Essen Sie viele kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt
- Lüften Sie beim Kochen, um starke Essensgerüche zu vermeiden und kochen Sie, wenn möglich, nicht selbst
- Essen Sie, worauf Sie gerade Lust haben
- Bevorzugen Sie energiereiche, fettbetonte Lebensmittel
- Hochkalorische Trinknahrung („Astronautenkost“) eignet sich gut als Zwischenmahlzeit
- Bitterstoffe wirken appetitanregend
Was kann Ihnen bei Geschmacksstörungen helfen?
- Spülen Sie Ihren Mund vor dem Essen und trinken Sie häufig kleine Mengen, wenn Sie unter schlechtem Geschmack leiden
- Bittere Getränke und Getränke mit Zitronenaroma regen den Speichelfluss an und mindern schlechten Geschmack
- Experimentieren Sie mit Gewürzen und neuen Geschmacksrichtungen
- Versuchen Sie Plastikbesteck, wenn Sie unter metallischem Geschmack leiden
- Bei Abneigung gegen rotes Fleisch versuchen Sie stattdessen Geflügelfleisch, Fisch, Tofu oder Eier, um Ihren Proteinbedarf zu decken
Wann sollten Sie Ihre Ärztin / Ihren Arzt kontaktieren?
Wenn Sie auf normalem Weg nicht mehr genug Nahrung zu sich nehmen können oder Sie trotz normaler Nahrungszufuhr an Gewicht verlieren, sollten Sie mit Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt sprechen.
Auf der Homepage von Eat What You Need e.V. finden Sie ergänzend viele gute Informationen und Rezepte. Weitere hilfreiche Quellen finden Sie in der Infothek in der Rubrik „Ernährung & Sport“.
Erschöpfung & Müdigkeit
Viele Patientinnen und Patienten leiden während, oder auch nach einer Krebstherapie, unter Erschöpfung und Müdigkeit. Fachleute bezeichnen das als Fatigue-Syndrom.
Fatigue kann sich von Mensch zu Mensch unterschiedlich äußern. Viele Betroffene sind trotz ausreichendem Schlaf ständig müde, schwach und kraftlos. Bei anderen stehen Antriebslosigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten im Vordergrund.
Was können Sie vorbeugend tun?
- Körperliche Aktivität – idealerweise an der frischen Luft – ist die beste Möglichkeit Fatigue vorzubeugen
- Regelmäßiges Ausdauertraining, z.B. Radfahren, Nordic-Walking oder Schwimmen, ist besonders geeignet
- Probieren Sie Tai Chi, Qi Gong oder Yoga
- Kostenlose Mitmachvideos (Gymnastik, Entspannung, Yoga) für Krebsbetroffene finden Sie z.B. in der Mediathek des CCC Mainfranken
- Der Austausch in einer onkologischen Sportgruppe kann helfen, im Alltag motiviert zu bleiben
Was kann Ihnen helfen, wenn Sie unter Fatigue leiden?
- Versuchen Sie trotz Müdigkeit und Erschöpfung aktiv zu bleiben
- Gestalten Sie Ihren Tagesablauf bewusst. Setzen Sie Prioritäten und gönnen Sie sich genügend Pausen. Um sich nicht zu unterfordern, aber auch nicht zu überfordern, kann ein „Energietagebuch“ sehr hilfreich sein
- Versuchen Sie Entspannungsübungen wie z.B. progressive Muskelrelaxation oder autogenes Training
- Akupunktur und Akupressur können sich positiv auf Fatigue auswirken
- Achten Sie auf einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus (weitere Tipps finden Sie weiter unten in der Rubrik Schlafstörungen)
Wann sollten Sie Ihre Ärztin / Ihren Arzt kontaktieren?
Sprechen Sie mit Ihrem Behandlungsteam, wenn die Erschöpfung Sie in Ihrer Alltagsgestaltung einschränkt. Möglicherweise sind Ihre Beschwerden durch Ursachen bedingt, die gut therapiert werden können (z.B. eine Blutarmut oder eine Störung der Schilddrüse).
Wenn Sie sich psychisch oder emotional erschöpft fühlen, kann eine psychosoziale Unterstützung sinnvoll sein. Ihr Behandlungsteam kann Ihnen kompetente Ansprechpartner vermitteln!
Werfen Sie auch einen Blick in unsere Infothek – in den Rubriken „Ernährung & Sport“ und „Psychoonkologie“ finden Sie weitere Informationen und Anlaufstellen in Ihrer Nähe.
Falls Sie an Brustkrebs erkrankt sind kann Ihr Arzt / Ihre Ärztin eine App zur Unterstützung bei Fatigue verordnen (Untire-App). Weitere Informationen hierzu finden Sie ebenfalls in der Infothek in der Rubrik „Apps auf Rezept“ oder auf der Webseite von Untire.
Gelenkschmerzen
Gelenkschmerzen – von Fachleuten auch als Arthralgie bezeichnet – ist eine Nebenwirkung, die vor allem bei antihormonellen Krebstherapien auftreten kann. Die sogenannten Aromatasehemmer – wie zum Beispiel der Wirkstoff Letrozol – lösen häufig Gelenkschmerzen aus. Diese werden bei hormonabhängigem Brustkrebs eingesetzt und hemmen die Bildung der weiblichen Sexualhormone (Östrogene). Da Östrogene wichtig für die normale Funktion der Gelenkknorpel und Knochen sind, vermutet man, dass die Unterdrückung der Östrogenbildung ursächlich für die Gelenkbeschwerden ist. Bei manchen Patientinnen kommen weitere Beschwerden wie Gelenksteifigkeit oder Muskel- und Knochenschmerzen dazu.
Worauf sollten Sie achten, wenn Gelenkschmerzen auftreten?
- Körperliche Aktivität und Sport können die Beschwerden lindern. Dabei ist gelenkschonendes Ausdauertraining, wie z.B. Radfahren, Nordic-Walking oder Schwimmen, besonders gut geeignet
- Eventuell bestehendes Übergewicht sollte reduziert werden, um die Gelenke zu entlasten
- Die Einnahme des Aromatasehemmers am Abend statt am Morgen kann helfen, Gelenkbeschwerden zu lindern
- Akupunktur kann sich positiv auf Gelenkschmerzen auswirken
- Ergänzend können Enzympräparate eingesetzt werden, die entzündungshemmend wirken. Außerdem sollte auf eine ausreichende Versorgung mit Calcium und Vitamin D geachtet werden, um die Knochenstruktur zu stärken
- In Rücksprache mit Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt können Schmerzmittel eingenommen werden
Wann müssen Sie Ihre Ärztin / Ihren Arzt kontaktieren?
- Wenn Sie durch die Beschwerden im Alltag eingeschränkt sind
- Wenn weitere Symptome wie Erschöpfung, Müdigkeit, Fieber, Gewichtsabnahme oder Nachtschweiß hinzukommen
Wenn die Beschwerden sehr ausgeprägt sind, wird Ihre Ärztin / Ihr Arzt eventuell eine Therapiepause oder ein Wechsel auf einen anderen Wirkstoff mit Ihnen besprechen. Wichtig ist jedoch: Setzen Sie Ihren Aromatasehemmer bitte in keinem Fall selbstständig ab!
Haarveränderungen & Haarausfall
Haarausfall ist meist eine der ersten Nebenwirkungen, die man mit einer Krebsbehandlung in Verbindung bringt. Viele – vor allem weibliche Patientinnen – haben deshalb große Angst davor, durch die Behandlung ihre Haare zu verlieren.
Bei klassischen Chemotherapien, die als Infusion gegeben werden, tritt Haarausfall tatsächlich sehr häufig auf. Auch während einer oralen Krebsbehandlung kann es zu Haarausfall kommen – glücklicherweise ist dieser hier aber meist viel weniger ausgeprägt. Außerdem gibt es auch viele orale Krebstherapien, die überhaupt keinen Haarausfall verursachen.
Wenn bei oralen Tumormedikamenten Haarveränderungen auftreten, äußern sich diese oft als dünner werdendes Haar. Einige Medikamente können auch zu einer Veränderung der Haarfarbe oder Haarstruktur führen. Das kann sowohl die Kopfhaare als auch die Wimpern betreffen (z.B. lange oder lockige Wimpern).
Was können Sie tun, um Haarausfall vorzubeugen?
Leider gibt es derzeit keine wirksame Maßnahme, um Haarveränderungen und Haarausfall während einer oralen Krebstherapie vorzubeugen. Bei klassischen, intravenösen Chemotherapien kann eine Kopfhautkühlung während der Infursion zur Vorbeugung von Haarausfall eingesetzt werden. Diese Behandlung kann allerdings auch Nebenwirkungen haben. Bei einer oralen Krebstherapie, die – anders als eine Infusion – täglich angewendet wird, hätte eine Kopfhautkühlung zudem keinen Effekt.
Worauf sollten Sie bei Haarveränderungen achten?
- Verwenden Sie ein besonders mildes Shampoo (z.B. Kindershampoo) und lassen Sie Ihr Haar möglichst an der Luft trocknen
- Vermeiden Sie eine weitere Belastung der Haare z.B. durch Färben, Glätten, Nutzung eines Lockenstabs
- Verzichten Sie auf Haarklammern, Gummibänder, Haarspray, Haargel und ähnliches
- Bei starkem Haarausfall können Sie sich eine Perücke verordnen lassen – Ihre Krankenkasse übernimmt hierfür die Kosten bzw. einen Teil der Kosten (je nach Kasse)
- Alternativ gibt es im Handel eine große Auswahl an Tüchern, Schals oder Mützen – hierbei sollten Sie darauf achten, Produkte aus natürlichen Materialien zu wählen (z.B. Baumwolle, Bambus, Seide)
- Wenn Ihre Wimpern zu lang werden und z.B. beim Tragen der Brille stören, können Sie diese vorsichtig mit einer Schere kürzen (lassen)
Hand-Fuß-Syndrom
Das sogenannte Hand-Fuß-Syndrom ist eine Hautreaktion, die vor allem an den Hand- und Fußflächen auftritt. Der Fachbegriff dafür lautet palmar-plantare Erythrodysästhesie. Typische Hinweise auf ein Hand-Fuß-Syndrom sind Rötungen, Schwellungen und Schmerzen an den Händen und Füßen. Bei den meisten Betroffenen sind die Handinnenflächen und Fußsohlen betroffen.
Was können Sie vorbeugend tun?
Dem Hand-Fuß-Syndrom kann man durch eine gute Hautpflege und dem Vermeiden von Druckstellen und starker Belastung der Hände und Füße in vielen Fällen gut vorbeugen.
Auf Folgendes sollten Sie im Alltag besonders achten:
- Hornhaut vor Therapiebeginn vorsichtig selbst entfernen oder entfernen lassen (z.B. medizinische Fußpflege)
- Hände und Füße mindestens 2 mal täglich mit 5-10%iger Harnstoff (Urea)-Creme eincremen
- Kontakt mit Hitzequellen (z.B. heißes Wasser, Wasserdampf) und reizenden Stoffen (z.B. Putzmittel) vermeiden
- Mechanische Belastung der Hände und Füße möglichst vermeiden (z.B. langes Gehen, Öffnen von Drehverschlüssen, enges Schuhwerk)
- Tragen Sie bequeme weite Schuhe und verwenden Sie ggf. Geleinlagen
Was können Sie tun, wenn das Hand-Fuß-Syndrom auftritt?
- Cremen Sie die Hände und Füße weiterhin und häufiger ein (3 bis 4 mal täglich)
- Achten Sie besonders darauf mechanische Belastungen und Hitzequellen zu vermeiden
- Tragen Sie keine Gummihandschuhe, sondern besser Baumwollhandschuhe, wenn Sie Ihre Hände schützen möchten
Wann müssen Sie Ihre Ärztin / Ihren Arzt kontaktieren?
- Wenn Sie Rötungen oder beginnende Blasenbildung an den Händen und / oder Füßen bemerken
- Wenn Sie durch die Nebenwirkung in Ihrem Alltag eingeschränkt sind
Es ist wichtig, dass Sie sich frühzeitig melden, sobald Ihnen Hautveränderungen auffallen bzw. wenn sich diese verschlimmern. Ihre Ärztin / Ihr Arzt kann Ihnen wirkstoffhaltige Cremes oder spezielle Wundverbände verschreiben, um die Beschwerden rasch zu lindern.
Hautausschlag
Hautausschlag und andere Hautveränderungen sind eine häufige Nebenwirkung einiger oraler Krebsmedikamente. Betroffen sind vor allem Wirkstoffe, die am sogenannten EGFR-Rezeptor angreifen. Diese Zielstruktur kommt nämlich nicht nur im Tumor, sonder auch in der gesunden Haut vor und wird dort „miterfasst“. Dadurch kommt es typischerweise zu Hautreaktionen, die in drei Phasen ablaufen:
- Phase 1 kennzeichnet sich durch akneartige Hautausschläge
- In Phase 2 nehmen die Hautausschläge ab, die Haut wird allerdings zunehmend trocken
- In Phase 3 ist die Haut extrem trocken, empfindlich und juckt häufig. Die Hautausschläge sind in dieser Phase meist abgeklungen.
Worauf sollten Sie vorbeugend achten?
Mit einer guten und konsequenten Basishautpflege kann man den Hautausschlägen in vielen Fällen gut vorbeugen, so dass sie nicht oder zumindest deutlich weniger ausgeprägt auftreten.
Darauf sollten Sie vorbeugend achten:
- Cremen Sie sich mindestens 2 mal täglich mit 5 – 10%iger Harnstoff (Urea)-Creme ein
- Nutzen Sie milde, seifenfreie Shampoos und Reinigungsprodukte und waschen Sie sich mit lauwarmem, nicht zu heißem Wasser
- Achten Sie auf guten UV-Schutz durch entsprechende Kleidung und Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor (mindestens 50)
- Tragen Sie leichte, bequeme und luftdurchlässige Kleidung aus Naturmaterialien (z.B. Baumwolle, Leinen, Seide)
- Vermeiden Sie starke mechanische Belastung der Haut (z.B. Haut mit dem Handtuch trocken tupfen, nicht rubbeln)
Was können Sie tun, wenn Hautreaktionen auftreten?
Wichtig ist, dass Sie die Basishautpflege weiterhin durchführen und intensivieren. Vermeiden Sie außerdem alles, was die Haut zusätzlich „stresst“. Dazu zählt mechanische Belastung z.B. durch Rasieren, enge Kleidung oder Rubbeln mit dem Handtuch, Hitzequellen wie heißes Wasser, Föhnen oder Wasserdampf, reizende Produkte wie Parfüm und direkte Sonneneinstrahlung.
Bei akneartigen Hautausschlägen ist es wichtig, die Pflege an die Phase der Hautreaktion (siehe oben) anzupassen:
- Phase 1 (Ausschläge): Verwenden Sie Reinigungsgele und verzichten Sie auf rückfettende Pflege. Falls gewünscht können Sie Make-up auf Wasserbasis nutzen, um den Ausschlag zu kaschieren. Verwenden Sie bitte keine freiverkäuflichen Akne-Produkte!
- Phase 2 (Austrocknung): Verwenden Sie Reinigungscremes und rückfettende Pflegeprodukte (z.B. Lipolotionen mit Dexpanthenol für das Gesicht, Lipolotionen mit 5-10% Harnstoff (Urea) oder Ceramiden für den Körper)
- Phase 3 (Trockene Haut): Verwenden Sie Reinigungscremes und rückfettende Pflegeprodukte wie in Phase 2. Zum Baden oder Duschen sind ergänzend Ölbäder bzw. Duschöle gut geeignet. Achten Sie besonders auf konsequenten UV-Schutz, da die Haut in dieser Phase oft sehr lichtempfindlich ist!
Wann sollten Sie Ihre Ärztin / Ihren Arzt kontaktieren?
- Wenn der Hautausschlag trotz der Basishautpflege schlimmer wird oder sehr ausgeprägt ist (z.B. wenn der gesamte Oberkörper betroffen ist)
- Wenn Sie durch die Nebenwirkung in Ihrem Alltag eingeschränkt sind
Es ist wichtig, dass Sie sich frühzeitig melden, sobald Ihnen Hautveränderungen auffallen bzw. wenn sich diese verschlimmern. Ihre Ärztin / Ihr Arzt kann Ihnen wirkstoffhaltige Cremes oder andere Medikamente verschreiben, um die Beschwerden rasch zu lindern.
Nagelveränderungen
Bei bestimmten klassischen Chemotherapien (vor allem den sogenannten Taxanen), die als Infusion gegeben werden, kommt es oft zu Nagelveränderungen. Es kann z.B. zur Verfärbung der Nägel kommen, die Nägel können spröde oder brüchig werden und es kann zu Nagelbettentzündungen kommen. Dabei können sowohl die Finger- als auch die Fußnägel betroffen sein. Auch während einer oralen Krebsbehandlung kann es zu Nagelveränderungen kommen.
Bei oralen Tumortherapien gehen die Nagelbeschwerden manchmal mit weiteren Beschwerden an den Fingern (z.B. Rissen in den Fingerkuppen) einher.
Was können Sie vorbeugend gegen Nagelveränderungen tun?
- Achten Sie auf eine schonende, vorsichtige Nagelpflege
- Feilen Sie die Nägel lieber, anstatt sie zu schneiden. Feilen Sie die Nägel nicht zu kurz und gerade
- Cremen Sie Nägel und Nagelhaut regelmäßig mit harnstoffhaltigen Cremes (Urea-Creme) ein
- Schützen Sie die Hand- und Fußnägel (z.B. Tragen von Baumwollhandschuhen bei Hausarbeit, vermeiden Sie enges Schuhwerk und übermäßige Maniküre/Pediküre)
- Vorbeugend kann zur Stärkung der Nägel eventuell ein spezieller, durchsichtiger Nagellack verwendet werden
Was können Sie tun, wenn Beschwerden an den Nägeln oder Fingerkuppen auftreten?
- Führen Sie die Nagelpflege weiterhin durch
- Bei schmerzhaften Rissen in den Fingerkuppen kann ein spezieller Wundkleber oder ein Sprühpflaster für Linderung sorgen
- Bei Nagelbettentzündungen sollten Sie die betroffenen Nägel mehrmals täglich in einer antiseptischen Lösung baden
Wann müssen Sie Ihre Ärztin / Ihren Arzt kontaktieren?
Bei einer Nagelbettentzündung sollten Sie Ihr Behandlungsteam kontaktieren. Eventuell benötigen Sie ein Antibiotikum, damit sich der Nagel nicht weiter infiziert. Bei Rissen in den Fingerkuppen, die trotz der oben genannten Tipps nicht ausheilen, kann Ihnen Ihre Ärztin / Ihr Arzt ggf. spezielle Verbände verschreiben.
Nervenschädigung
Bei bestimmten Krebsmedikamenten kann eine Nervenschädigung als Nebenwirkung auftreten. Fachleute sprechen auch von Neuropathie.
Typische Beschwerden, die auf eine Neuropathie hinweisen, sind u.a. Gefühlsstörungen, Ameisenlaufen, pelzige, taube oder eingeschlafene Füße und Hände, Schmerzen oder auch Ohrgeräusche (sogenannter Tinnitus) und Muskelschwäche.
Wichtig zu wissen: in den meisten Fällen erholen sich die Nerven nach Abschluss der Krebstherapie wieder und die Beschwerden verschwinden mit der Zeit.
Worauf sollten Sie vorbeugend achten?
Gezieltes Bewegungs- und Gleichgewichtstraining kann helfen, die Nervenenden „bei Laune zu halten“ und Beschwerden durch eine Nervenschädigung vorzubeugen. Folgende Übungen können Sie in Ihren Alltag einbauen:
- Koordinationstraining, wie z.B. Balancieren auf einer Handtuchrolle, Stehen auf einem Bein
- Training der Feinmotorik, wie z.B. Knöpfe öffnen/schließen, Handarbeiten wie Stricken oder Häkeln
- Sogenanntes sensomotorisches Training kann helfen, die Nervenenden – v.a. in den Händen und Füßen – zu aktivieren. Das ist z.B. durch Barfußlaufen oder Fühlbäder mit getrockneten Bohnen, Erbsen oder Rapssamen möglich. Auch die Massage der Hände/Füße mit einem Igelball ist sinnvoll. Mitmachvideos (z.B. Videos sensomotorisches Training, heimischer Barfußpfad) finden Sie z.B. in der Mediathek des CCC Mainfranken
Was kann Ihnen helfen, wenn eine Nervenschädigung auftritt?
Intensivieren Sie das Bewegungs- und Gleichgewichtstraining (siehe oben) – achten Sie dabei stets auf einen sicheren Stand und trainieren Sie ggf. unter professioneller Anleitung, wenn Sie sich unsicher fühlen. Mögliche Anlaufstellen, die Bewegungsangebote speziell für Krebsbetroffene anbieten, finden Sie in unserer Infothek in der Rubrik „Ernährung & Sport“.
Zusätzlich können folgende Tipps hilfreich sein:
- Elektrotherapie in Form von Teilbädern der Hände und/oder Füße mit Gleichstrom (sog. Zwei- oder Vierzellenbad) kann die Nerven stimulieren und die Beschwerden lindern. Solche Therapien werden oftmals in Reha-Einrichtungen oder Physiotherapie-Praxen angeboten
- Nutzen Sie, falls nötig, Hilfsmittel, um sich den Alltag zu erleichtern (z.B. Griffhilfen zum Öffnen von Flaschen)
- Wenn Sie sich unsicher beim Gehen oder Stehen fühlen, nutzen Sie einen Gehstock oder Rollator und beseitigen Sie mögliche Stolperfallen (z.B. Teppichkanten) in Ihrem Zuhause
- Bei Empfindungsstörungen oder Taubheitsgefühlen kann es leicht zu Verletzungen kommen, weil Schmerzreize nicht mehr richtig wahrgenommen werden! Nutzen Sie Topflappen auch für lauwarme oder sehr kalte Gegenstände und z.B. besser einen Nagelklips anstelle einer Nagelschere
- Bei Ohrgeräuschen kann es helfen, angenehme Musik laufen zu lassen
Wann sollten Sie Ihre Ärztin / Ihren Arzt kontaktieren?
- Bei neu auftretenden Empfindungsstörungen (z.B. Kribbeln), Schmerzen oder Taubheitsgefühlen
- Wenn Sie Lähmungserscheinungen, Muskelschwäche oder brennenden Schmerz an den Füßen beobachten
Sprechen Sie mit Ihrem Behandlungsteam, wenn Sie unter Beschwerden leiten, die auf eine Nervenschädigung hinweisen können. Ihre Ärztin / Ihr Arzt kann entscheiden, ob Ihnen zum Beispiel verschreibungspflichtige Medikamente oder andere Maßnahmen weiterhelfen können.
Schlafstörungen
Schlafstörungen können durch drei verschiedene Beschwerdebilder gekennzeichnet sein: Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen und / oder frühmorgendliches Erwachen. Wenn eine dieser Beschwerden mindestens dreimal pro Woche über einen Monat oder länger auftritt und Sie dadurch im Alltag eingeschränkt sind, spricht man definitionsgemäß von einer Schlafstörung oder Insomnie.
Was können Sie vorbeugend tun, um guten und erholsamen Schlaf zu fördern?
Es gibt einige allgemeine Tipps zur sogenannten Schlafhygiene, die helfen können, Schlafstörungen vorzubeugen:
- Ihr Schlafzimmer sollte kühl (18-19 °C), leise und dunkel sein
- Verzichten Sie vor dem Zubettgehen auf Laptop, Handy oder Tablet
- Achten Sie auf einen festen Schlaf-Wach-Rhythmus mit festen Schlafens- und Aufstehzeiten – möglichst auch am Wochenende
- Halten Sie, wenn überhaupt, nur einen kurzen Mittagsschlaf (ca. 30 Minuten)
- Bauen Sie ein Abendritual auf, das Sie auf den Schlaf vorbereitet z.B. Entspannungsübungen oder angenehme, ruhige Musik
- Wenn Sie 15 Minuten nach dem Zubettgehen noch wach sind, stehen Sie auf und gehen Sie in ein anderes Zimmer. Gehen Sie erst wieder ins Bett, wenn Sie sich schläfrig fühlen
Was kann Ihnen helfen, wenn Sie unter Schlafstörungen leiden?
- Versuchen Sie Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung, autogenes Training oder Fantasiereisen. Hilfreiche Videos dazu finden Sie z.B. in der Mediathek des CCC Mainfranken
- Entdecken Sie Yoga, Tai-Chi oder Qi Gong für sich. Bauen Sie die Übungen z.B. in Ihr Abendritual ein
- Versuchen Sie sich tagsüber ausreichend zu bewegen
- Verzichten Sie auf koffeinhaltige Getränke und Alkohol und vermeiden Sie schwere Mahlzeiten am Abend
- Sprechen Sie mit Ihrem Behandlungsteam, ob schlaffördernde oder beruhigende Medikamente (z.B. pflanzliche Präparate mit Baldrian, Lavendel etc.) für Sie in Frage kommen
Wann sollten Sie Ihre Ärztin / Ihren Arzt kontaktieren?
Wenn sich Ihre Schlafstörungen verschlechtern oder Sie trotz der oben genannten Maßnahmen nicht erholsam schlafen, sprechen Sie mit Ihrem Behandlungsteam. Ihre Ärztin / Ihr Arzt kann entscheiden, ob z.B. verschreibungspflichtige Medikamente für Sie sinnvoll wären.
Übelkeit & Erbrechen
Viele Krebsbehandlungen können Übelkeit und Erbrechen auslösen. Fachleute bezeichnen dies als Nausea und Emesis. Ob Beschwerden auftreten, hängt dabei von vielen Faktoren ab – z.B. von der Art und Dosierung der Medikamente und auch von patientenindividuellen Faktoren wie Alter, Geschlecht und Vorbelastung. Auch orale Krebsmedikamente können zu Übelkeit und Erbrechen führen.
Wichtig zu wissen: Mittlerweile gibt es viele verschiedene Medikamente zur Vorbeugung von Übelkeit und Erbrechen, sodass Patientinnen und Patienten sehr viel seltener unter diesen Beschwerden leiden als das früher der Fall war!
Worauf sollten Sie vorbeugend achten?
Grundsätzlich ist es so, dass Ihnen Ihre Ärztin / Ihr Arzt ein oder mehrere Medikamente zur Vorbeugung (sogenannte Antiemetika) verschreiben wird, wenn Ihre Therapie dafür bekannt ist, häufig zu Übelkeit oder Erbrechen zu führen. In diesem Fall ist es besonders wichtig, dass Sie diese Medikamente auch tatsächlich vorbeugend einnehmen und nicht abwarten, bis Beschwerden auftreten. Geben Sie Ihrem Behandlungsteam auch Bescheid, falls die Medikamente nicht ausreichend wirken. Sie müssen diese Nebenwirkungen in keinem Fall „aushalten“!
Zusätzlich zur richtigen Einnahme der Antiemetika, können folgende Tipps helfen Übelkeit vorzubeugen:
- Lieber mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt essen, als wenige große Mahlzeiten
- Sehr süße und fettige Speisen und starke (Essens)-Gerüche vermeiden
- Kalte Speisen und Getränke werden oft besser vertragen als warme
Wie sollte ich mich verhalten, wenn trotzdem Beschwerden auftreten?
- Wenn Ihnen Ihre Ärztin / Ihr Arzt Bedarfs-Medikamente gegen Übelkeit verschrieben hat, nehmen Sie diese wie verordnet ein. Falls Ihnen nichts verordnet wurde, kontaktieren Sie Ihr Behandlungsteam und schildern Sie Ihre Beschwerden.
- Essen Sie langsam und kauen Sie gut, trinken Sie ausreichend (v.a., wenn Sie auch erbrechen müssen)
- Trockene und milde Speisen wie Zwieback, Reis, Bananen, Brot oder salziges Knabbergebäck werden oftmals gut vertragen. Vermeiden Sie große Mahlzeiten und sehr süße, fettige oder blähende Speisen
- Ingwer wirkt gegen Übelkeit. Sie können z.B. Ingwertee oder Ingwerwasser mit frischem Ingwer trinken oder Ingwerstücke kauen. Wenn Sie den Geschmack von Ingwer nicht mögen, können Sie in Ihrer Apotheke auch Ingwerpulver in Kapselform erhalten
- Ergänzend kann Akupunktur oder Akupressur hilfreich sein
Wann müssen Sie Ihre Ärztin / Ihren Arzt kontaktieren?
- Wenn Sie unter starkem Erbrechen leiden (mehr als 3 mal pro Stunde)
- Wenn Sie wegen der Beschwerden nicht mehr genügend essen und trinken können
- Bei blutigem Erbrechen oder wenn das Erbrochene wie Kaffeesatz aussieht
Verstopfung
Verstopfung – von Fachleuten auch als Obstipation bezeichnet – kann während einer Krebsbehandlung auftreten. Die Beschwerden müssen dabei nicht unbedingt durch die Krebstherapie selbst verursacht sein. Oftmals sind auch Flüssigkeitsmangel, zu wenig Bewegung oder Ernährungsprobleme der eigentliche Auslöser der Verstopfung. Neben einigen Krebsmedikamenten gibt es zudem andere Medikamente (z.B. starke Schmerzmittel, bestimmte Medikamente gegen Übelkeit), die häufig zu Verstopfung führen.
Wichtig zu wissen: Stuhlfrequenz und -beschaffenheit sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Von Verstopfung spricht man, wenn die Stuhlgänge seltener als üblich auftreten (z.B. weniger als 3 mal pro Woche) oder die Stuhlentleerung erschwert ist. Zusätzliche Beschwerden können Bauchschmerzen oder -krämpfe sein.
Was können Sie selbst tun, wenn Sie unter Verstopfung leiden?
- Versuchen Sie mindestens 2 Liter pro Tag zu trinken (z.B. Kräutertee, stilles Wasser)
- Achten Sie auf eine ballaststoffreiche Ernährung (siehe weiter unten) – steigern Sie die Menge an Ballasstoffen langsam, sonst kann es zu Blähungen und Bauchschmerzen kommen
- Versuchen Sie – soweit es Ihnen möglich ist – sich ausreichend zu bewegen
- Vermeiden Sie blähende Speisen und stopfende Lebensmittel (z.B. Kakao, schwarzer/grüner Tee, der lange gezogen hat, Blaubeeren)
- Falls Ihnen Medikamente zum Abführen verschrieben wurden (sogenannte Laxantien), nehmen Sie diese wie verordnet ein. Falls nicht sprechen Sie mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt, ob solche Medikamente für Sie sinnvoll wären
Folgende Lebensmittel wirken der Verstopfung entgegen:
- Ballaststoffreiche Lebensmittel wie Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, rohes Gemüse, frisches Obst wie Pflaume, Kiwi oder Mange, Trockenfrüchte wie z.B. gedörrte Pflaumen oder Feigen
- Quellende Lebensmittel wie indische Flohsamen(schalen), Weizenkleie oder Leinsamen. Diese Lebensmittel sollten Sie nur zusammen mit viel Wasser zu sich nehmen, ansonsten kann sich die Verstopfung verschlimmern!
- Milchzucker (Lactose) und milchsauer vergorene Lebensmittel wie Sauerkraut oder Joghurt können ergänzend eingesetzt werden
Wann sollten Sie Ihre Ärztin / Ihren Arzt kontaktieren?
- Wenn die Verstopfung, trotz der oben genannten Maßnahmen, länger als 3 Tage anhält
- Bei sehr schmerzhaften Stuhlgängen oder starken Bauchkrämpfen
- Bei blutigen Stuhlgängen
Wechseljahresbeschwerden
Wechseljahresbeschwerden werden durch einen Mangel an Geschlechtshormonen verursacht. Ein solcher Mangel kann die Folge einer Chemotherapie sein, die die Geschlechtsorgane schädigt. Ein Hormonmangel kann aber auch „gewollt“ sein, wenn es sich um eine Antihormontherapie handelt. Diese setzt man insbesondere bei hormonabhängigem Brustkrebs ein, um das Krebswachstum zu unterdrücken.
Typische Wechseljahresbeschwerden können Hitzewallungen und Schweißausbrüche, Scheidentrockenheit, Stimmungsschwankungen und depressive Verstimmung sein. Fachleute bezeichnen diese auch als menopausale Symptome. Auch Gelenkbeschwerden und Schlafprobleme können dazu zählen. Informationen hierzu finden Sie in den Rubriken Gelenkschmerzen und Schlafstörungen.
Welche Tipps können Ihnen bei Wechseljahresbeschwerden helfen?
Bei Hitzewallungen und Schweißausbrüchen kann Folgendes helfen:
- Akupunktur, Yoga und achtsamkeitsbasierte Stressreduktion können die Beschwerden lindern
- Trinken Sie ausreichend, vermeiden Sie jedoch Alkohol und koffeinhaltige Getränke
- Versuchen Sie ggf. Übergewicht zu reduzieren
- Meiden Sie sehr scharfe und fette Speisen
- Sprechen Sie mit Ihrem Behandlungsteam, ob pflanzliche Medikamente mit Traubensilberkerze für Sie in Frage kommen
Bei Scheidentrockenheit können Ihnen diese Tipps helfen:
- Verwenden Sie befeuchtende Gele, Cremes oder Vaginalzäpfchen – es können auch Präparate mit Milchsäure oder Vitamin C eingesetzt werden, um den natürlichen (sauren) pH-Wert der Schleimhaut wiederherzustellen bzw. zu schützen
- Nutzen Sie parfümfreie Hygieneprodukte und vermeiden Sie übermäßige Intimhygiene, um die natürliche Barrierefunktion der Schleimhaut zu schützen
- Tragen Sie Unterwäsche aus natürlichen Materialien (z.B. Baumwolle) und vermeiden Sie Synthetik
- Versuchen Sie Beckenbodentraining
- Vermeiden Sie Nikotin und Kaffee
Hormonhaltige Cremes werden oft bei Scheidentrockenheit eingesetzt. Diese sollten Sie als Krebspatientin allerdings nie ohne Rücksprache mit Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt verwenden, da dadurch die Wirkung der Antihormontherapie abgeschwächt werden kann!
Wenn Sie unter Stimmungsschwankungen leiden, sollten Sie Folgendes beachten:
- Achten Sie auf Ihre Bedürfnisse
- Versuchen Sie Yoga oder Akupunktur
- Bewegen Sie sich ausreichend und achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung
- Fragen Sie Ihr Behandlungsteam nach Unterstützung, wenn Sie sich psychisch oder emotional erschöpft oder überfordert fühlen! Weitere Informationen und mögliche Anlaufstellen hierzu finden Sie in der Infothek in der Rubrik „Psychoonkologie“
Pflanzliche Medikamente mit Johanniskraut wirken zwar stimmungsaufhellend, können aber zu starken Wechselwirkungen mit vielen Medikamenten führen. Nehmen Sie deshalb johanniskrauthaltige Präparate nie ohne Rücksprache mit Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt ein!
Wann sollten Sie Ihre Ärztin / Ihren Arzt kontaktieren?
- Bei häufigen und nächtlichen Schweißausbrüchen
- Wenn Sie zusätzliche Beschwerden wie Schmerzen, Fieber oder ungewollten Gewichtsverlust beobachten
- Bei Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen oder häufigem Harndrang
- Bei anhaltend übelriechendem Ausfluss aus der Scheide
- Wenn Sie unter depressiven Symptomen leiden, die länger als zwei Wochen anhalten