Orale Krebstherapie
Oral bedeutet „über den Mund“. Orale Krebstherapien – auch orale Tumortherapien genannt – sind Krebsmedikamente, die man als Tablette oder Kapsel einnimmt. Wir helfen Ihnen orale Krebstherapie besser zu verstehen.
Hier erfahren Sie:
- Was Sie bei einer oralen Krebstherapie beachten müssen
- Wann eine orale Therapie eingesetzt wird
- Wie diese Medikamente wirken
Möchten Sie die Informationen zum Nachlesen ausdrucken? Laden Sie unsere Informationsmerkblätter als PDF herunter – achten Sie einfach auf das Download-Symbol!
Was sind die Vorteile einer oralen Krebstherapie?
Eine orale Therapie hat einige Vorteile gegenüber einer intravenösen Krebstherapie, die als Infusion über die Vene verabreicht wird:
- Bequeme Anwendung: die Einnahme erfolgt selbstständig zu Hause
- Weniger Zeitaufwand: keine langen Wartezeiten für Infusionen, meist seltenere Arztbesuche
- Kein Infusionszugang nötig: reduziert das Risiko für Infektionen oder andere Komplikationen durch einen Katheter
Trotz dieser Vorteile ist eine orale Krebstherapie nicht für jede Krebserkrankung oder jeden Betroffenen geeignet. Ihr Behandlungsteam entscheidet anhand verschiedener Faktoren, ob eine orale Therapie für Sie infrage kommt. Weitere Informationen hierzu finden Sie weiter unten.
Worauf muss man bei einer Krebstherapie in Tablettenform achten?
Damit die Therapie wirksam und sicher ist, gibt es einige wichtige Punkte zu beachten:
Der sichere Umgang mit oralen Krebsmedikamenten
Orale Krebsmedikamente sind hochwirksam – deshalb müssen sie sorgfältig gehandhabt werden, um andere Personen nicht unnötig zu gefährden.
Das Wichtigste auf einen Blick:
- Angehörige sollten Handschuhe tragen, wenn Sie orale Krebsmedikamente anfassen
- Sie als Patientin oder Patient müssen keine Handschuhe tragen, sollten sich aber vor und nach der Einnahme gründlich die Hände mit Seife waschen. So verhindern Sie, dass Rückstände auf Gegenstände wie Türklinken übertragen werden
- Zerkleinern, mörsern oder teilen Sie Tabletten/Kapseln nicht! Dadurch kann der Wirkstoff unkontrolliert freigesetzt werden
- Lutschen oder kauen Sie das Krebsmedikament nicht – das kann zu Reizungen der Mundschleimhaut führen
- Schwangere und stillende Frauen sowie Kinder dürfen nicht mit oralen Krebsmedikamenten in Kontakt kommen
- Bewahren Sie das Krebsmedikament in der Originalverpackung auf, um Verwechslungen zu vermeiden. Von der Vorbereitung der Tabletten oder Kapseln zusammen mit Ihren anderen Tabletten in Wochendosetten (Medikamentenbox) ist deshalb eher abzuraten
Falls Ihnen die Einnahme wegen Schluckproblemen schwer fällt, haben wir Hinweise zur erleichterten Einnahme in einem Informationsmerkblatt für Sie zusammengefasst:
Außerdem sollten Sie folgende generelle Empfehlungen zum richtigen Medikamentenumgang beachten:
- Nicht im Bad, der Küche oder auf der Heizung lagern! Medikamente sollten trocken und kühl stehen – ideal ist z.B. ein Medikamentenschrank im Flur
- Temperatur beachten! Die meisten Tabletten bzw. Kapseln können Sie bei Raumtemperatur (meist unter 25 – 30 Grad) aufbewahren. Manche müssen jedoch im Kühlschrank (bei 2 – 8 Grad) gelagert werden
- Nehmen Sie Ihr Medikament immer in etwa zur gleichen Uhrzeit ein
- Nehmen Sie die Tabletten bzw. Kapseln immer möglichst aufrecht sitzend oder stehend mit einem großen Glas (mind. 200 ml) Leitungswasser ein
- Achten Sie darauf, ob ein Abstand zu den Mahlzeiten nötig ist. Mehr dazu erfahren Sie weiter unten.
Sie möchten ausführliche Informationen zum richtigen Umgang mit Ihrem Medikament ausdrucken? Hier können Sie das Informationsmerkblatt ansehen und herunterladen:
Der richtige Abstand zur Nahrung
Bei vielen Medikamenten beeinflusst Nahrung die Aufnahme des Wirkstoffes aus dem Darm in den Blutkreislauf. Ja nach Medikament sind unterschiedliche Effekte durch Nahrung möglich:
- Zusammen mit Nahrung wird mehr Wirkstoff ins Blut aufgenommen
- Zusammen mit Nahrung wird weniger Wirkstoff ins Blut aufgenommen
- Die Aufnahme des Wirkstoffs wird durch Essen nicht beeinflusst, deshalb kann das Medikament unabhängig vom Essen eingenommen werden
Je nach Medikament muss deshalb ein Abstand zum Essen eingehalten werden oder die Einnahme ist unabhängig vom Essen möglich.
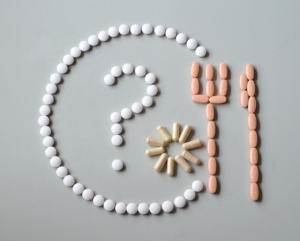
Einnahme zum, nach oder ohne Essen? Das kann je nach Medikament unterschiedlich sein! Bildquelle: Pixabay (congerdesign)
Welche Einnahmevorschriften gibt es bezüglich der Mahlzeiten?
- Nüchtern: mindestens 1 Stunde vor oder mindestens 2 Stunden nach dem Essen
- Mit dem Essen: Einnahme direkt mit oder kurz nach einer Mahlzeit
- Unabhängig von den Mahlzeiten: Einnahme mit einer Mahlzeit oder nüchtern
Warum ist das wichtig?
Nimmt man ein Medikament, das nüchtern eingenommen werden soll, fälschlicherweise mit dem Essen, kann das – je nach Wirkstoff – zu mehr Nebenwirkungen oder einer abgeschwächten Wirkung führen. Dies ist natürlich gerade bei Krebsmedikamenten sehr problematisch.
Beachten Sie deshalb unbedingt den empfohlenen Einnahmezeitpunkt bezüglich der Mahlzeiten.
Wechselwirkungen vermeiden
Die Wirkstoffmenge im Blut kann nicht nur durch Nahrung, sondern auch durch bestimmte Nahrungsmittel oder durch andere Medikamente beeinflusst werden. Diese können Eiweiße in der Leber (sog. Cytochrom-Enzyme), die am Abbau von Medikamenten beteiligt sind, beeinflussen. Das führt entweder dazu, dass das Medikament schneller oder langsamer abgebaut wird. Die Folge kann eine zu starke Wirkung (d.h. mehr Nebenwirkungen) oder eine abgeschwächte Wirkung sein.

Lassen Sie Ihre Medikamente regelmäßig auf Wechselwirkungen prüfen! Bildquelle: Pixabay (Gundula Vogel)
Viele orale Krebsmedikamente werden über das sog. Cytochrom CYP3A4 abgebaut, das von einigen anderen gebräuchlichen Medikamenten beeinflusst werden kann. Deshalb ist es bei einer oralen Krebstherapie besonders wichtig zu prüfen, ob Wechselwirkungen mit Ihren anderen Medikamenten auftreten können. Falls das der Fall ist, muss Ihr Behandlungsteam eventuell Ihre Medikamente anpassen, indem zum Beispiel die Dosis geändert wird oder Sie auf ein alternatives Medikament umgestellt werden.
Vorsicht bei Grapefruit und Johanniskraut
Die Inhaltsstoffe von Grapefruits und Bitterorangen, haben einen starken Einfluss auf die Cytochrom-Enzyme und können zu verstärkten Nebenwirkungen vieler Krebsmedikamente führen. Der Effekt hält nach dem Genuss sogar mehrere Tage an! Für andere Früchte, wie z.B. Sternfrüchte oder Granatäpfel, sind ähnliche Effekte beschrieben, wobei sie wahrscheinlich weniger stark ausgeprägt sind.

Vorsicht bei Grapefruits – hier kommt es oft zu Wechselwirkungen! Bildquelle: Pixabay (Mihai Negrea)
Johanniskraut führt dagegen zu einer Abschwächung vieler Krebsmedikamente. Es ist als pflanzliches Medikament ohne Rezept erhältlich und wird meist bei Stimmungsschwankungen eingesetzt.
Mittel gegen Sodbrennen
Medikamente gegen Sodbrennen oder Magenbeschwerden führen durch eine Veränderung des pH-Werts im Magen zu einer schlechteren Aufnahme vieler oraler Krebsmedikamente. Dadurch kann die Wirkung der Krebstherapie abgeschwächt sein!
Zu den Medikamenten, die hier Probleme machen können, zählen:
- Protonenpumpenhemmer (PPI) wie z.B. Omeprazol oder Pantoprazol
- H2-Antagonisten (z.B. Famotidin)
- Kurzwirksame Antazida (z.B. Calciumcarbonat, Magaldrat, Aluminiumhydroxid), die meist in Form von Kautabletten oder Flüssigkeiten zum Schlucken angewendet werden
Wenn Sie solche Medikamente einnehmen, sollte Ihr Behandlungsteam unbedingt einen Wechselwirkungs-Check durchführen.
Weitere mögliche Wechselwirkungen
Grundsätzlich ist es von Ihrem Krebsmedikament abhängig, ob die genannten Wechselwirkungen auftreten oder nicht. Darüber hinaus gibt es noch viele andere Wirkstoffe, die hier nicht aufgeführt sind, die ebenfalls zu Wechselwirkungen führen können.
Wichtig: Informieren Sie Ihr Behandlungsteam über alle Medikamente, die Sie einnehmen. Das gilt auch für Präparate, die Sie ohne Rezept erhalten (z.B. Nahrungsergänzungsmittel, pflanzliche Präparate oder Vitamin-Präparate)!
Nebenwirkungen vorbeugen
Orale Krebstherapien können zu Nebenwirkungen wie z.B. Hautreaktionen, Magen-Darm-Beschwerden oder Müdigkeit führen.
Was können Sie tun?
- Informieren Sie sich über mögliche Nebenwirkungen
- Fragen Sie Ihr Behandlungsteam nach vorbeugenden Maßnahmen
- Kontaktieren Sie Ihr Behandlungsteam bei ungewöhnlichen, starken oder anhaltenden Beschwerden
Mehr zum Thema erfahren Sie unter Nebenwirkungen.
Therapietreue beachten
Anders als bei einer Infusionsbehandlung, die Ihnen in einer Klinik oder Praxis verabreicht wird, haben Sie als Patientin oder Patient bei einer oralen Krebstherapie eine hohe Eigenverantwortung, die Therapie richtig durchzuführen.
Regelmäßige und richtige Einnahme ist entscheidend für den Erfolg der Therapie!
Die Gründe für eine nicht optimale Therapietreue können sehr vielfältig sein. Vergesslichkeit, die Angst vor Nebenwirkungen, Probleme beim Schlucken oder mangelndes Vertrauen in den Nutzen der Therapie können solche Gründe sein.

Medikamente können nur wirken, wenn Sie regelmäßig eingenommen werden. Bildquelle: modifiziert nach Pixabay (Alexandra Koch)
Was können Sie tun?
✔ Halten Sie sich genau an die Einnahmeempfehlungen
✔ Nutzen Sie einen Einnahmeplan oder eine Medikamenten-App
✔ Sprechen Sie mit Ihrem Behandlungsteam, wenn Sie Schwierigkeiten haben Ihr Medikament wie verordnet einzunehmen
Sie möchten detaillierte Tipps, die Ihnen helfen können Ihr Medikament regelmäßig einzunehmen und die Informationen ausdrucken? Laden Sie sich unser Informationsmerkblatt herunter:
Kann jede Krebstherapie oral eingenommen werden?
In Deutschland gibt es aktuell über 130 verschiedene orale Krebsmedikamente. Sie werden zur Behandlung vieler Krebsarten eingesetzt, zum Beispiel bei Lungenkrebs, Hautkrebs, Brustkrebs oder Prostatakrebs.
Allerding kann nicht jedes Krebsmedikament als Tablette oder Kapsel eingenommen werden. Viele Wirkstoffe eignen sich dafür nicht, weil:
- sie im Magen-Darm-Trakt nicht richtig aufgenommen werden oder
- sie durch die Magensäure zerstört werden.
Kann jede Krebserkrankung mit Tabletten behandelt werden?
Heutzutage können viele Krebsarten mit oralen Krebsmedikamenten behandelt werden. Dafür muss das Medikament aber eine Zulassung für die jeweilige Erkrankung haben. Diese Zulassung erhält es nur, wenn Studien belegen, dass es wirksam und sicher ist.
Es gibt aber auch Krebserkrankungen, für die bisher keine oralen Krebsmedikamente zugelassen wurden. In diesen Fällen werden andere Therapien eingesetzt, zum Beispiel:
- Krebstherapie mit Infusionen
- Operation
- Bestrahlung
- eine Kombination der oben genannten Therapien
Ob ein Krebsmedikament in Tablettenform eingesetzt werden kann, hängt zudem von weiteren Faktoren ab:
- Krankheitsstadium – Ist der Krebs in einem frühen Stadium oder fortgeschritten?
- Frühere Therapien – Wurde bereits eine andere Behandlung durchgeführt?
- Genetische Eigenschaften des Tumors – Manche Medikamente wirken nur, wenn der Tumor bestimmte Veränderungen im Erbgut (Mutationen) aufweist. Das ist besonders bei Kinaseinhibitoren wichtig.
Selbst wenn zwei Patienten die gleiche Krebserkrankung haben, kann es daher sein, dass nur einer von ihnen ein orales Medikament bekommt.
Wie wirken orale Krebsmedikamente?
Orale Krebsmedikamente können unterschiedlich wirken. Je nach Wirkprinzip werden sie in vier Gruppen eingeteilt:
- Chemotherapie – zerstört Krebszellen oder bremst ihr Wachstum
- Hormontherapie – blockiert Hormone, die das Wachstum bestimmter Tumoren fördern
- Immunmodulatoren – beeinflussen das Immunsystem, um Krebszellen zu bekämpfen
- Zielgerichtete Therapien (z.B. Kinasinhibitoren) – greifen gezielt in Signalwege der Krebszellen ein, um deren Wachstum zu stoppen
Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der einzelnen Wirkstoffe auf die vier Gruppen:
Klicken Sie auf die jeweilige Gruppe, um mehr über das Wirkprinzip zu erfahren:
Chemotherapie
Eine Chemotherapie mit sogenannten Zytostatika ist eine seit Langem bewährte Methode zur Behandlung von Krebs. Einige dieser Medikamente werden bereits seit den 1960er Jahren eingesetzt. Die meisten Chemotherapien werden als Infusion angewendet, es gibt aber auch Medikamente, die als Tabletten oder Kapseln eingenommen werden.
Wie wirken Zytostatika?
Zytostatika bremsen das Wachstum von Krebszellen oder zerstören sie. Sie wirken besonders auf Zellen, die sich schnell teilen – dazu gehören Krebszellen, aber leider auch einige gesunde Zellen. Besonders betroffen sind Zellen der Schleimhäute, Haarwurzeln und des Knochenmarks. Deshalb können Nebenwirkungen wie Entzündungen im Mund, Haarausfall oder eine eingeschränkte Bildung von Blutzellen auftreten. Letzteres kann zu Müdigkeit führen oder Patienten anfällig für Infektionen machen.
Beispiele für orale Zytostatika:
- Capecitabin
- Trifluridin
- Tegafur
- Temozolomid
Diese Medikamente werden zur Behandlung verschiedener Krebserkrankungen wie Darmkrebs, Magenkrebs oder Hirntumoren eingesetzt.
Hormontherapie
Bestimmte Krebsarten, wie hormonabhängiger Brust- oder Prostatakrebs, wachsen durch körpereigene Hormone. Eine Hormontherapie kann diesen Krebszellen die benötigten Hormone entziehen oder ihre Wirkung blockieren.
Beispiele für Hormontherapien:
- Brustkrebs: sogenannte Aromatasehemmer (Letrozol, Exemestan und Anastrozol), Tamoxifen
- Prostatakrebs: Abirateron, Bicalutamid, Enzalutamid, Darolutamid
Durch die Veränderung des Hormonhaushalts können Nebenwirkungen auftreten. Sowohl Männer als auch Frauen können Symptome ähnlich den Wechseljahren entwickeln, wie Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen oder Gelenkschmerzen. Auch die Knochendichte kann abnehmen, was das Risiko für Osteoporose erhöht.
Immunmodulatoren
Immunmodulatoren beeinflussen das Immunsystem und werden vor allem bei einer speziellen Form von Blutkrebs, dem Multiplen Myelom, eingesetzt. Zu dieser Gruppe gehören:
- Lenalidomid
- Thalidomid
- Pomalidomid
Thalidomid ist der Wirkstoff, der früher im Schlafmittel Contergan enthalten war. Seit dem Contergan-Skandal ist bekannt, dass Thalidomid bei Kindern zu schweren Missbildungen führt, wenn es während der Schwangerschaft eingenommen wird. Aus diesem Grund gibt es besondere Sicherheitsvorschriften bei der Anwendung der Immunmodulatoren.
Typische Nebenwirkungen der Immunmodulatoren sind zum Beispiel Müdigkeit, eine erhöhte Anfälligkeit für Gefäßverschlüsse (Thrombosen) und Veränderungen der Blutbildung.
Zielgerichtete Tumortherapie
Zielgerichtete Tumortherapien wirken anders als klassische Chemotherapien. Während Chemotherapie alle schnell wachsenden Zellen angreift – auch gesunde – sind zielgerichtete Medikamente so entwickelt, dass sie möglichst nur Krebszellen beeinflussen. Sie blockieren gezielt bestimmte Strukturen auf den Krebszellen, die für deren Wachstum notwendig sind. Idealerweise kommen diese Strukturen nur in Krebszellen vor oder sind dort viel häufiger als in gesunden Zellen. Dadurch können Krebszellen gezielt zerstört werden, während gesunde Körperzellen geschont werden.
Somit treten typische Nebenwirkungen der Chemotherapie, wie Haarausfall, Schleimhautentzündungen oder eine stark erhöhte Infektanfälligkeit, seltener auf. Allerdings sind zielgerichtete Medikamente nicht nebenwirkungsfrei – sie haben nur ein anderes Nebenwirkungsprofil. Häufige Beschwerden sind zum Beispiel Hautreaktionen, Durchfall oder Ermüdung.
Kinaseinhibitoren: Schlüssel-Schloss-Prinzip gegen Krebs
Die meisten zielgerichteten oralen Tumormedikamente sind sogenannte Kinaseinhibitoren (oft auch Tyrosinkinase-Inhibitoren oder TKI genannt). Diese Medikamente funktionieren nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip: sie blockieren gezielt bestimmte Eiweiße, die sogenannten Kinasen, die für die Signalübertragung in der Krebszelle wichtig sind.
Man kann sich das so vorstellen: Die Kinase ist das „Schloss“, und der Kinaseinhibitor ist der „Schlüssel“. Passt der Schlüssel ins Schloss, wird das Signal unterbrochen, das die Krebszelle zum Wachsen anregt. Ohne dieses Signal kann die Krebszelle nicht überleben und stirbt ab.
Oft wirken diese Medikamente nur dann, wenn eine bestimmte genetische Veränderung (Mutation) in der Krebszelle vorliegt. Ärztinnen und Ärzte können durch Tests an einer Tumor- oder Blutprobe feststellen, ob eine solche Mutation vorhanden ist und ob eine Kinaseinhibitor-Therapie infrage kommt.
Der erste Kinaseinhibitor, Imatinib, wurde 2001 in Deutschland zugelassen und wird zur Behandlung bestimmter Leukämieformen eingesetzt. Heute gibt es über 65 verschiedene Kinaseinhibitoren, darunter Abemaciclib, Cabozantinib, Dabrafenib, Osimertinib und Palbociclib. Sie werden bei vielen Krebsarten eingesetzt, z.B. Brustkrebs, Hautkrebs, Lungenkrebs und bestimmten Leukämien. Man erkennt Kinaseinhibitoren an der Endung „-nib“ oder „-clib“.
Andere zielgerichtete Tumormedikamente
Neben Kinaseinhibitoren gibt es weitere zielgerichtete Krebsmedikamente in Tablettenform, die auf andere Weise wirken.
Zwei Beispiele sind:
- PARP-Inhibitoren nutzen eine Schwäche von Krebszellen mit bestimmten genetischen Veränderungen (z.B. BRCA-Mutationen) aus. Diese Zellen sind auf ein Reparaturenzym namens PARP angewiesen, um Schäden in ihrem Erbgut zu reparieren. Wird PARP gehemmt, können sich diese Schäden anhäufen – bis die Krebszelle abstirbt. Gesunde Zellen haben alternative Reparaturmechanismen und werden weniger stark beeinträchtigt. Beispiele für PARP-Inhibitoren sind Olaparib, Niraparib und Rucaparib, die vor allem bei Brust-, Eierstock- und Prostatakrebs eingesetzt werden.
- Proteasom-Inhibitoren: Proteasome sind für Zellen wie eine Müllabfuhr: Sie entsorgen fehlerhafte oder überflüssige Eiweiße. Krebszellen produzieren besonders viele solcher fehlerhaften Eiweiße – und sind daher stark auf eine funktionierende „Müllabfuhr“ angewiesen. Proteasom-Inhibitoren blockieren diese Funktion. Dadurch sammeln sich fehlerhafte Eiweiße in der Krebszelle an, bis sie daran zugrunde geht. Ein Beispiel für ein solches Medikament ist Ixazomib, das vor allem beim Multiplen Myelom, einer bestimmten Form von Blutkrebs, eingesetzt wird.





